Schon der erste Teil unserer Rechts-Serie mit Medien-Anwalt Prof. Dr. Gero Himmelsbach war extrem lehrreich für uns. Im zweiten Teil des Interviews wollten Stephan und ich genauer wissen, wo bloggende Journalisten aus rechtlicher Sicht besonders aufpassen müssen.
„Der Blogger muss sich an die gleichen Grundsätze halten wie jeder Journalist“
Karsten: Was sind denn eigentlich die größten rechtlichen Fallstricke beim Bloggen?
Ich glaube, dass der 1. Fallstrick zunächst eine oft schizophrene Sicht des Bloggers ist: Einerseits meinen viele Blogger, im Internet müsse man sich doch viel freier bewegen können als im echten Leben. Und anderseits besteht die Angst, wegen irgendwelcher Kleinigkeiten abgemahnt zu werden. Aber tatsächlich sind die rechtlichen Vorgaben im Internet zunächst genau die gleichen wie in der Print-Welt. Das heißt: Der Blogger muss sich an die gleichen Grundsätze halten, an die er sich auch als Print-Journalist halten würde.
Karsten: Vielleicht jetzt mit einem kleinen Unterschied – am Freitag hat der Bundesrat ja das Leistungsschutzrecht für Verlage durchgewunken. Nun haben viele Blogger Sorge, dass bei ihnen bald die Abmahnungen der Verlage ins Haus flattern…
Ich denke, die Sorge ist unbegründet. Blogger sind keine „Aggregatoren“ im Sinne der neuen Bestimmung. Wenn Blogger selbst Texte schreiben und darin Ausschnitte aus geschützten Medieninhalten nutzen, kommt es alleine auf das Zitatrecht an. Die neuen Regelungen greifen hier nicht.
Stephan: Was sind denn dann die wichtigsten Punkte, die ich beachten muss?
Es sind meiner Erfahrung nach vor allem vier Bereiche:
- Die Schmähkritik.
- Ein Eingriff in die Privat- oder Intimsphäre anderer Personen.
- Verstoße gegen das Urheberrecht.
- Unwahre Tatsachenbehauptungen.
Karsten: Was genau ist nochmal die Schmähkritik?
Hier steht die Diffamierung einer Person im Vordergrund und es findet keine Auseinandersetzung mit einer Sachfrage statt. „Politiker X ist ein fettes Schwein“ wäre so ein Klassiker. Dazu muss man aber sagen: Auch härteste Kritik in Sachfragen ist grundsätzlich durch die Meinungsfreiheit nach Art 5 Abs. 1 des Grundgesetzes geschützt. Du kannst kommentieren und kritisieren – solange Du die Grenze zur Diffamierung nicht überschreitest. Ich glaube aber, dass hier das Risiko einer Rechtsverletzung bei einem ausgebildeten Journalisten minimal ist.
Stephan: Wie sieht es mit den Persönlichkeitsrechten aus?
Das ist schon diffiziler. Denn gerade bei Prominenten ist es oft schwer zu definieren, was noch öffentlich ist und was privat. Gerade bei Personen, die ihr Privatleben sehr stark selbst in die Öffentlichkeit tragen. Prinzipiell kann man sagen, dass immer ein gewisses Risiko gegeben ist, wenn ich nicht über das berufliche Leben der jeweiligen Person schreibe.
„Das Twitter-Bild hat jemand gemacht. Und garantiert nicht der Blogger“
Karsten: In dem Zusammenhang kommen wir vielleicht sofort zum Urheberrecht. Wie ist das denn mit den Twitter-Fotos der Stars, die so gerne von diversen Medien und auch Bloggern veröffentlicht werden?
Nun urheberrechtlich ist die Sache klar: Das Bild hat jemand gemacht. Und garantiert nicht der Blogger. Also müsste man eigentlich den Urheber fragen, ob man das Bild verwenden darf und gegebenenfalls ein Honorar zahlen. Dazu kommt das Recht am eigenen Bild der abgebildeten Personen. Da die das meist aber selbst twittern, sehe ich hier nicht so das Problem.
Stephan: Und urheberrechtlich dann auch nicht?
Nun ja, wenn sie wollten, könnten die Stars jederzeit die Medien verklagen, die ihre Twitterbilder ungefragt veröffentlichen. Ob sie das tun, steht auf einem anderen Blatt, denn viele machen das vermutlich mit dem Ziel, in die Medien zu kommen – aber sicher ist das nicht. Natürlich gehen große Medien das Risiko auch notfalls ein.
Karsten: Greift hier nicht das Zitat-Recht?
Wenn Du nur das Foto nimmst, auf keinen Fall. Wenn Du Dich mit dem Foto auseinandersetzt oder – noch besser – einen Screenshot des Tweets zeigst oder einer Webseite, vielleicht. Dann kann es ein zulässiges Bild-Zitat sein. Nach dem Motto: „Schau. Lieber User, das findest Du auf den Seiten von Star X“ – am besten noch mit einem Link zu den Seiten.
„Abschreiben schützt vor Strafe nicht“
Stephan: Wie ist es mit Text-Zitaten? Wie viel kann ich denn zitieren?
Das wird in der Rechtssprechung unterschiedlich gehandhabt – deshalb kann ich das so pauschal nicht beantworten. Nimm mal diesen Text:
„JenaKultur versäumte es, im Vorfeld darüber aufzuklären, dass die Veranstaltung „Beats statt Böller“ laut Aussage einer Sprecherin als „Alternative zu den allseits bekannten Rummtata-Silvesterpartys“ gedacht war. Was für den Veranstalter ein Kommunikationsfehler, bedeutete für viele Partygäste einen verdorbenen Silvesterabend.“ (Quelle: https://jenanews.de/index.php/nachrichtenarchiv/kultur/51-nachrichten/2912-kommentiert-silvester-reinfall-im-volksbad).
Das OLG Jena hat den Text als urheberrechtlich geschützt angesehen. Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang eine andere Sache, die oft falsch gemacht wird: Abschreiben schützt vor Strafe nicht.
Karsten: Wie meinst Du das?
Wenn man eine unwahre Tatsachenbehauptung oder eine Schmähkritik aus einem anderen Medium weiter verbreitet, schützt mich auch der Verweis auf die Quelle nicht. Ich kann den gleichen Ärger bekommen wie der ursprüngliche Verfasser. Es ist so, als hätte ich die Behauptung selbst aufgestellt.
Stephan: Wie kann ich mich dagegen schützen?
Indem Du mehrere Facetten beleuchtest, also schreibst: Quelle X behauptet dies und jenes, Quelle Y sagt aber das und Quelle Z hat eine ganz andere Information. Also journalistisch abwägen und klar machen, dass es nur eine Information von vielen ist. Dann machst Du Dir die eine Behauptung nicht zu eigen und musst dafür nicht wie für eine eigene Äußerung gerade stehen.
Karsten: Kommen wir zum 4. Punkt: die unwahre Tatsachenbehauptung. Für eine solche kann ich doch eine Gegendarstellung bekommen?
Hierzu muss man zunächst einmal feststellen, ob Deine Internetseite überhaupt ein journalistisch-redaktionell gestaltetes Telemedienangebot nach dem Rundfunkstaatsvertrag ist. Ein Indiz ist, wenn es kontinuierlich geändert und modifiziert wird.
Stephan: Ich finde, wenn wir uns als Journalisten im Netz begreifen, dann müssen wir auch in Kauf nehmen, dass der Rundfunkstaatsvertrag bei unseren Angeboten greift. Was also tun, wenn mir eine Gegendarstellung ins Haus flattert?
Auch das ist wieder eine wirtschaftliche Frage. Lasse ich zu, dass der Gegner die Gegendarstellung einklagt, können hohe Kosten entstehen. Also sollte man es sich wieder gut überlegen und dann die Gegendarstellung ggf. ohne Anerkennung einer Rechtspflicht veröffentlichen.
„Man könnte der Gegenseite einen fairen Betrag anbieten“
Karsten: Und die Kostennoten des Anwalts?
Sind auch nicht selbstverständlich. Wenn es wirklich eine unwahre Behauptung war, könnte man der Gegenseite einen Betrag anbieten. 250 Euro könnten in einem solchen Fall fair sein.
Stephan: Worüber müsste ich eigentlich bloggen, wenn ich möglichst schnell abgemahnt werden möchte?
Details über das intime Verhältnis von Günter Jauch und Heidi Klum – das es natürlich nicht gibt!
Im dritten Teil unserer Interview-Serie mit Prof. Dr. Gero Himmelsbach: Die besondere rechtliche Situation von Kommentaren.
Hier geht’s zum ersten Teil.
[hr]
ACHTUNG: Als besonderen Service für alle LousyPennies-Leser hat Prof.Dr. Gero Himmelsbach einen (kostenlosen) Musterbrief verfasst, mit dem Ihr auf eventuelle Abmahnungen reagieren könnt. Natürlich ohne Gewähr – und in der Hoffnung, dass Ihr ihn nie brauchen werden.
[hr]
Über Gero Himmelsbach
Professor Dr. Gero Himmelsbach ist seit 1994 Rechtsanwalt und Mitarbeiter der Sozietät Romatka in München, seit 1998 Partner. Er ist Honorarprofessor für Medienrecht der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Autor des Praxis-Handbuches „Beck’sches Mandatshandbuch Wettbewerbsrecht“ und Mitherausgeber des Kommentars zum Bayerischen Mediengesetz. Daneben ist Gero Himmelsbach ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift GRUR-Prax (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht).
Gero Himmelsbach ist seit vielen Jahren in der Aus- und Fortbildung von Journalisten und Juristen tätig – etwa als Referent der Hanns-Seidel-Stiftung und der Bayerischen Akademie für Fernsehen oder als Dozent für Wettbewerbsrecht der BeckAkademie.
Gero Himmelsbach ist u.a. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Verlagsjustitiare, des PresseClub München e.V./International Press Club of Munich und war 1984 Mitgründer des Vereins „Nachwuchsjournalisten in Bayern (NJB) e.V.“, der junge Journalisten unterstützt.








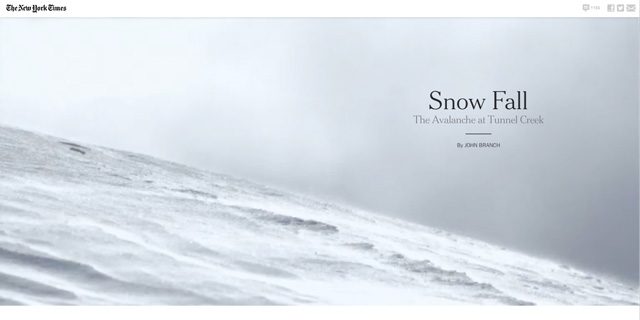
![von Gilles Rousselet (Achenbach Foundation for Graphic) [Public domain], via Wikimedia Commons](https://www.lousypennies.de/wp-content/uploads/2013/03/Herakles720.jpg)
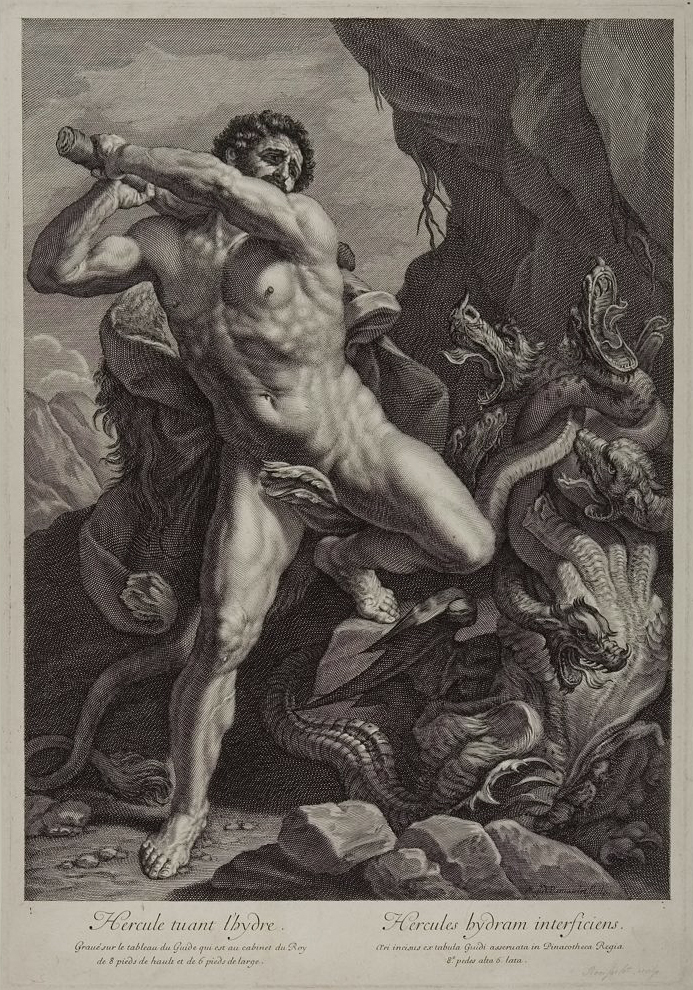




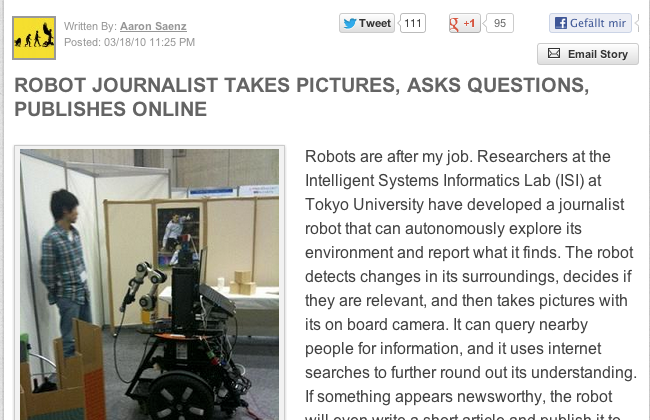
![von Mosmas (Eigenes Werk) [GFDL oder CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons](https://www.lousypennies.de/wp-content/uploads/2013/03/vertical-towers.jpg)